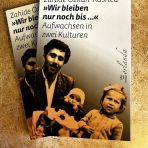Neuenhain (Sc) – Eine ganz besondere Lesung fand in der vergangenen Woche in der Seniorenresidenz Augustinum in Neuenhain statt: Dr. Zahide Özkan-Rashed, zahlreichen Bad Sodener Bürgerinnen und Bürgern als Ärztin bekannt, war eingeladen, aus ihrem autobiografischen Roman „Wir bleiben noch bis … – Aufwachsen in zwei Kulturen“ zu lesen. Der Besuch, so wusste Sandra Zechiel, Kulturreferentin des Augustinums, zu berichten, ging auf den Wunsch mehrer Bewohnerinnen des Augustinums zurück, die Dr. Özkan-Rashed persönlich kennen, um ihre Migrationsgeschichte wissen und zudem auch das Buch bereits gelesen hatten. Der Roman, obwohl namentlich verfremdet, weist starke autobiografische Züge auf, worauf Dr. Özkan-Rashed eingangs ihrer Lesung auch hinwies und was im Verlauf der sehr kurzweiligen Lesung auch deutlich wurde.
Das Buch entstand anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, das im Jahr 1955 seinen Ursprung nahm. Dieses Abkommen, so Dr. Özkan-Rashed, war es, das ihr Leben von Grund auf veränderte und einen Prozess bedingte, in dem sie sich zunächst „zwischen zwei Kulturen“ bewegte, bevor sie ihre eigenen Entscheidungen traf – manchmal sehr zum Leidwesen ihrer Eltern.
Angekommen, aber nicht „zuhause“
Mit ihrer offenen und zugewandten Art fiel es der Autorin leicht, eine gute Verbindung zu ihren zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern aufzubauen, und so begann sie ihre Lesung mit einer kurzen Einführung in jene Zeiten der 60er Jahre, in denen sie als 2-jähriges Kind und Tochter eines „Gastarbeiters“ mit ihrer Schwester und Mutter nach Deutschland kam. Die Familie folgte dem Vater, der 1962 eigentlich nur für zwei Jahre zum arbeiten nach Deutschland gehen wollte, jedoch im Anschluss länger blieb und seine Familie deshalb „nachholte“. Geplant waren zwei weitere Jahre in Deutschland, aus denen später noch so viele mehr werden sollten. Ein Bruder wurde geboren und die Familie erarbeitete sich einen größeren Wohlstand, der jedoch weniger in Deutschland als vielmehr in der Türkei sichtbar wurde, denn dort bauten die Eltern in ihrem Heimatdorf ein Haus. Alles, so erläuterte Dr. Özkan-Rashed, war auf die spätere Rückkehr ausgelegt, das „Bleiben“ sei eigentlich nie eine wirkliche Option gewesen, was das Ankommen in Deutschland und die Integration erschwerten sollte.
Schwierige Integration
Da die Rückkehr in die türkische Heimat immer im Fokus gestanden habe, sei diesem Gedanken alles untergeordnet worden. Wohlstand fand in der Türkei statt, nicht in Deutschland, wo die Möbel der Gastarbeiter teilweise vom Sperrmüll stammten. Auch sprachlich taten sich erhebliche Barrieren auf, da zuhause lediglich türkisch gesprochen wurde – was sich negativ auf den Spracherwerb und die Kommunikationsfähigkeit in der Schule ausgewirkt habe. Integrations- und Sprachkurse, so wie sie heute angeboten werden, gab es in den 60er und 70er Jahren nicht, so dass sich die Schulkinder sehr bemühen mussten, mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern überhaupt mithalten zu können. Viele „Gastarbeiterkinder“ seien deshalb auch auf die Förderschule gegangen und nur wenige haben es auf das Gymnasium geschafft. Ein weiteres Integrationshemmnis sei auch die beständige Rückkehrabsicht der Eltern gewesen, denn eine tatsächliche Rückkehr fand über viele Jahre nicht statt und ließ die Kinder in einem ständigen „Wartemodus“ verharren. Mit ihrer sehr persönlichen „Lebenserzählung“ eröffnete die Autorin ihren Leserinnen und Lesern einen ganz neuen Blickwinkel auf die „Gastarbeitergeneration“ und zeigte gleichzeitig auf, warum die Integration – auch für die Kinder – damals so schwierig war.
Einfaches Leben
Das Leben der Familie in Deutschland sei, so Dr. Özkan-Rashed, ein sehr einfaches gewesen, denn der Wohlstand wurde regelrecht „aufgespart“ und in die Zukunft verlagert – in die Zeit, wenn das Haus in der türkischen Heimat fertiggestellt sein sollte. Darüber hinaus war die Familie in Deutschland mit dem „System“ überfordert. Mangelnde Sprachkenntnisse, die „Ausgrenzung“ durch die deutsche Gesellschaft und die Tatsache, dass eine Teilnahme an z.B. Klassenfahrten mit Übernachtung für die Kinder unmöglich war, habe es ihr schwer gemacht, in Deutschland Fuß zu fassen.
Rebellische Jugend
Irgendwann, und das war mit den Kindern der „Gastarbeiter“ nicht anders, werden die Eltern „peinlich“, was das familiäre Zusammenleben nicht einfacher macht. In den Gastarbeiterfamilien sei dieser Prozess des „Erwachsenwerdens“ oft konfliktreicher abgelaufen, da das heimatliche Traditions-bewusstsein der Eltern auf den deutschen Lebensstil der Kinder traf. Auch Dr. Özkan-Rashed wusste aus diesen schwierigen Zeiten zu berichten und las z.B. aus Tagebucheinträgen, die die gesellschaftliche Zerrissenheit ihrer Protagonistin widerspiegeln. Im Alter von Mitte zwanzig stellte sie sich dann, im Rahmen des Medizinstudiums, die Frage: „Will ich eigentlich zurück in die Türkei?“ Die Eltern hatten das Studium ermöglicht und träumten von einer Karriere der Tochter als Ärztin in ihrem Heimatland, denn der Erfolg der Tochter habe dem Leben der Eltern in Deutschland weiter einen Sinn gegeben – auch nachdem das angestrebte Haus in der Türkei fertig war. Der Konflikt sei vorprogrammiert gewesen, denn die Eltern akzeptierten die Entscheidung der Tochter, in Deutschland zu praktizieren, zunächst nicht.
Konflikte
Der unrealistische Wunsch der Eltern, die Tochter möge mit ihnen in die Türkei zurückkehren, habe ein großes Konfliktpotenzial eröffnet. Sie sei als rebellisch wahrgenommen worden und wollte sich nicht unterordnen, was von den Eltern als Kontrollverlust wahrgenommen worden sei. Die Frage „Wo bleibt der Dank?“ habe lange im Raum gestanden, so die Autorin. Aber: Die Tochter war stark und setzte ihren Willen durch – heute blickt sie, durch die Augen ihrer Protagonistin, deutlich milder auf die Zeiten zurück, in denen sie sich von den Eltern unverstanden fühlte.
Angekommen, um zu bleiben
Die Lebensrealitäten sprechen heute für sich: Nach ihrem Abitur in Neu-Isenburg studierte Dr. Zahide Özkan-Rashed Medizin in Frankfurt am Main und arbeitet seit 1989 als Ärztin mit Fachrichtung Innere Medizin und Kardiologie. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern.
Ihre schriftstellerische Tätigkeit hat ihre Ursprünge in ihrer Jugend, als sie anfing, ihre Gedanken und Gefühle in einer Art Tagebuch niederzuschreiben. Später überarbeitete sie die Texte und veröffentlichte ihre Erfahrungen als Buch, das sich thematisch mit Migration, Integration, Identität, Heimat, Inter- und Multikulturalität beschäftigt.