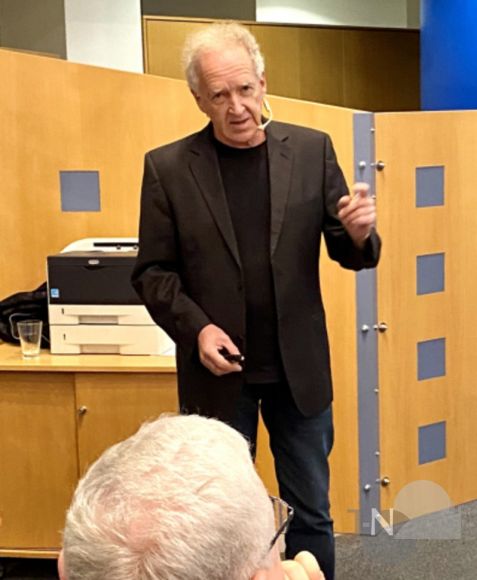Königstein (aks) – Auch wenn es viele Skelette und andere fossile Funde auch in unseren Breitengraden gab, die von der Existenz der ersten Menschen vor fast zwei Millionen Jahren zeugen, stellt der Paläoanthropologe Dr. Friedemann Schrenk von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und Professor für Paläobiologie und Umwelt an der Goethe-Universität, klar: „Der moderne Mensch stammt aus Afrika“. Es gebe nicht den geringsten Zweifel: Nur dort durchlief „Homo“ alle Vorstufen vom Menschenaffen über den Vormenschen bis zum modernen Menschen, den vor allem seine sozialen Fähigkeiten und seine Werkzeuge – seine Technik – bis heute auszeichneten „lückenlos“. Der „Homo sapiens“ sei als erster in der Lage gewesen, die erlernten Techniken an andere zu vermitteln. Damit unterschied er sich von allen anderen Lebewesen.
Mensch und Technik
„Noch vor einer Woche betrieb Prof. Schrenk Feldforschung in Afrika“, so begrüßte Prof. Dr. Diether Döring – seines Zeichens Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler und Vorsitzender des Königsteiner Forums – am Montagabend in der Frankfurter Volksbank, den renommierten Wissenschaftler. Vom „Homo sapiens“ zum „Homo digitalis“, diese Entwicklung mache sich an der Technik fest, derer sich der Mensch über Millionen Jahre bediente und für die er viel „Hirn“ brauchte. „Homo digitalis“, so Döring, sei ein bewusst provokanter Begriff für die Exzellenz-Vortragsreihe 2020, die die Wechselwirkung Mensch und Technik untersuche. Viele namhafte Referenten konnte er für das kommende Jahr gewinnen, die meisten kluge Köpfe von Hochschulen, andere direkt aus der Wirtschaft und von Bundesagenturen. Das sei seiner „Hartnäckigkeit“ zu verdanken und darauf ist er sichtlich stolz. Elf Vorträge finden im neuen Jahr (fast) monatlich in der Frankfurter Volksbank statt.
Künstliche Intelligenz
Der „Homo sapiens“ entwickelte als „klug handelnder Mensch“ zunächst Werkzeuge, später Maschinen und Rechner. Als „Homo digitalis“ stehe er heute vor der Herausforderung „maschineller intelligenter Systeme“, die für unsere Zukunft entscheidend seien. Intelligent wäre eine „neue Schraubendrehung hinsichtlich der Möglichkeiten“, die eine Katastrophe, nämlich die Zerstörung unseres Planeten, verhindern helfe, so Döring. Dafür müsse das Verhältnis Technik und Mensch untersucht werden in einem Zeitalter, in dem Maschinen in der Lage sind zu lernen – mit weitreichenden Konsequenzen für uns und unsere gesellschaftlichen Systeme. Ein Blick auf die Welt solle in weiteren Vorträgen Informationen liefern hinsichtlich Ethik, Wettbewerb, Datenschutz, Verteidigung und Rechtsfragen. „Können wir noch den Stecker ziehen?“, so lautet die finale Frage, die sich nicht nur Döring als Mastermind in Sachen Zeitgeist und wissenschaftliche Trends stellt.
Evolution des Menschen
Friedemann Schrenk begann seinen gut verständlichen, fast launigen Vortrag mit der Projektion von King Kong mit blonder Dame. „Solche Wesen gab es wirklich“, das Publikum schmunzelt, das kann er doch nicht wirklich ernst meinen, oder doch? Menschenaffen „hatten keine Technik“, das sei der wesentliche Unterschied zum „Homo sapiens“. Als Wissenschaftler, der Fossilien analysiert, ginge es ihm um Hypothesen, da gebe es kein Richtig oder Falsch, nur wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Schließlich sei da „kein Zettel dran, die fossilen Überreste sind ohne Sprache, ohne Hirn“. Dabei interessiere ihn die Frage: Seit wann gibt es Menschen? Schrenk forscht im Labor und vor Ort in Afrika sowie an anderen Fundstellen: „Was geschah in 300.000 Generationen der Evolution und, vor allem, was geschah mit unserem Gehirn?“
Der aufrechte Gang
Vor acht Millionen Jahren begann die Entwicklung der Menschenaffen zu den „Hominini“, Vormenschen, die aufrecht gingen, weil sie sich von aquatischen Pflanzen im Wasser der afrikanischen Savanne ernähren mussten und nicht schwimmen konnten! Dieser Tribus hatte kein größeres Gehirn als die Menschenaffen und immer noch gewaltige Eckzähne, die ausschließlich für Drohgebärden, also zur Vormachtstellung innerhalb, nicht außerhalb, der Gemeinschaft dienten. Das Gebiss sei im Übrigen ein wichtiges Indiz für Paläoanthropologen, dass diese Affen-Menschen über wenig Sozialverhalten verfügten. Während sich das Gehirn des „homo erectus“ vergrößerte, verkleinerten sich die Eckzähne und erhöhte sich die soziale Kompetenz. Die Hirnmasse des „Homo sapiens“ entspreche in etwa der unsrigen. Das Denken erlaubte es dem Menschen, Hilfsmittel, vor allem für die Nahrungsbeschaffung und deren Bearbeitung, zu schaffen.
Know-how als kulturelle Losung
„Die ersten Steinwerkzeuge sind der Beginn der Gattung Mensch“, stellt Schrenk fest. Die Weitergabe dieses Wissens als „kulturelle Losung“ verbreitete sich nicht über die Gene, sondern über die Nachahmung. Kultur bedeute immer eine bewusste Entscheidung für das Lernen und für die Weiterentwicklung – Lehre und Forschung im Urzustand sozusagen. In einer Schimpansen-Gemeinschaft werde nichts tradiert, obwohl auch Affen lernfähig seien und sogar rechnen könnten. Der Einsatz von Werkzeugen führte zu einer Unabhängigkeit von Natur und Umwelt, aber zu einer Abhängigkeit von Technik und Werkzeugen, so primitiv sie auch waren. Der Menschenforscher bringt es auf den Punkt: „Der Blackout“ beginnt hier“ und noch drastischer formuliert er: „Der Mensch hat schon immer die Umwelt zerstört“ .
Hirn und Darm
Nicht die absolute Hirnmasse sei für die Evolution entscheidend, sondern das Verhältnis des Gehirns zum restlichen Körper. Kleinere Menschen hätten auch kleinere Gehirne. Da das Gehirn stark „energieverbrauchend“ sei, musste Energie schnell verfügbar sein. Ein kurzer Darm war dabei von Vorteil. Eine günstige Wende nahm die Ernährung, als die ersten Menschen sich das Feuer zunutze machten und ihre Nahrung kochten: „Das Kochen wurde vor 1,5 Millionen Jahren erfunden.“ Während Menschenaffen noch rohe Pflanzenfasern verdauen und in Energie umwandeln mussten, war die gegarte Nahrung und vor allem gekochtes Fleisch schneller für den Körper und für das Gehirn verfügbar.
Fleisch war eindeutig ein „Kick off“ für die Evolution. So wurde im Laufe der Zeit immer weniger Darmkapazität für die Verdauung von rohen Lebensmitteln benötigt. Der Darm bildete sich zurück und überließ dem Gehirn sozusagen die Priorität: Das sei der „bio-kulturelle Vorteil“ zu anderen menschenähnlichen Wesen, wie dem Nussknackermensch, der vor zwei Millionen Jahren in Ostafrika vorkam und der mit einem riesigem Kauapparat – und kleinem Gehirn – ausgestattet war, damit er die harte Nahrung der Savannen zerkleinern und verwerten konnte.
Schrenk fasst das anschaulich zusammen: „Langer Darm kleines Gehirn, kurzer Darm großes Gehirn – beides geht nicht.“
Zwei Prozent Neandertaler in uns
Unsere nächsten Vorfahren, die Neandertaler, besiedelten Europa vor 400.000 Jahren – parallel zum „Homo sapiens“ in Afrika. Sie hatten eine helle Hautfarbe als Anpassung an sonnenärmere Regionen, damit genügend Vitamin D aus der Umwelt aufgenommen werden konnte. Schrenk ließ acht Millionen Jahre rasant und bildhaft Revue passieren und hielt die Besucher der Frankfurter Volksbank mit seinem komplexen Vortrag in Atem. Etwas gibt er uns am Ende noch mit auf den Weg: „Überall gab es Vermischungen“, es gebe keine Art, die sich nicht mit einer anderen vermischt hätte. Dies sei das Wesen der Evolution: die Weitergabe von Genen und beim Menschen auch von Wissen.