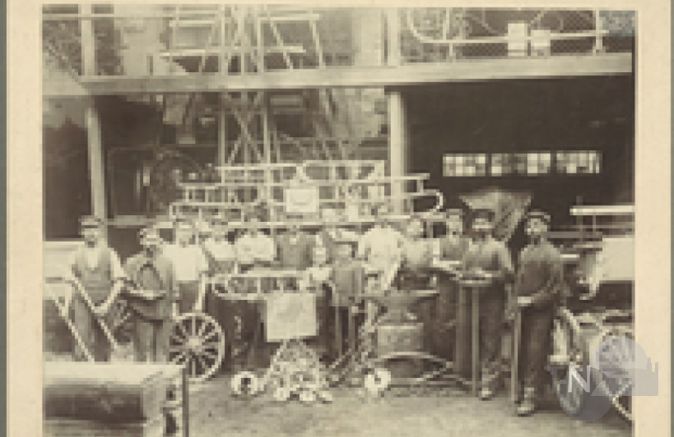Kronberg (kb) – Am 1. Oktober 1891 eröffnete Johann Christian Heinrich Kunz im Hause seiner Eltern in der heutigen Tanzhausstraße 12 in Kronberg sein Geschäft als Hufschmied und Wagenbauer. 2016 feiert die daraus entstandene Werkzeugmaschinenfabrik Johann Kunz Söhne ihr 125-jähriges Firmenjubiläum – ein bewegter Teil Industriegeschichte Kronbergs mit vielen Wendepunkten.
Johann Christian Heinrich Kunz wurde am 1. Januar 1867 als zweiter Sohn von Balthasar Kunz und Anna Hirsch geboren. Seine Vorfahren waren allesamt Schmiede und seit 1734 in Kronberg ansässig. Johann Kunz lernte den Beruf des Schmieds sowohl in Frankfurt am Main als auch in Meisenheim am Glan. Danach ging er auf Wanderschaft, die ihn unter anderem an die Fachschule für Wagenbau in München und zu einer Kutschenfabrik in Eisennach führte.
Nach seinem abgeleisteten Militärdienst in Meiningen zog es ihn wieder in das aufstrebende Kronberg zurück, wo er zunächst Breaks und Jagdwagen für die Kronberger Bürger herstellte, so dass er alsbald mehr Platz brauchte und eine größere Schmiedewerkstatt am damaligen Ortsrand in der Hartmutstaße 1 errichtete.
Zu seinem Kundenkreis gehörte Kaiserin Friedrich, die ihn mit dem Beschlagen ihrer Pferde, der Instandsetzung ihres Wagenparks und dem Neubau von Equipagen beauftragte. Johann Kunz heilte ihre englische Lieblingsstute von einer Hufkrankheit und zum besonderen Ausdruck ihres Danks ernannte sie ihn im Jahre 1899 zu ihrem Hoflieferanten.
Der Tod der Kaiserin und das Aufkommen des Automobils führten zum ersten Wendepunkt der Firma. Von nun an wurde die Fabrikation auf Geschäfts- und Spezialwagen, Pferdeomnibusse sowie Kadaverwagen ausgerichtet. In seiner Werkstatt wurde der legendäre Brieftaubenwagen mit Dunkelkammer für den Apotheker Dr. Julius Neubronner gebaut. Ein Modell dieses Wagens ist im Deutsche Technikmuseum in Berlin ausgestellt.
In dieser Zeit blühte der Rodelsport in Kronberg auf und Johann Kunz entwickelte den Taunus Rodel, ein Rodel aus gebogenem Eschenholz und Doppelprofileisen, die ihm sowohl auf Eis, als auch auf Schnee eine gute Führung gaben. Den Rodel ließ er 1907 patentieren und er wurde in Stückzahlen zu Tausenden gebaut.
Um sich zunächst selbst die Schmiedearbeit zu erleichtern, entwickelte Johann Kunz im Jahre 1908 einen besonderen Federhammer, der sich feinfühlig regulieren ließ. Wurden die Schmiedehämmer am Anfang noch in Lizenz gefertigt, so entschied er sich – nach dem Konkurs des Lizenznehmers – in den Maschinenbau einzusteigen und die Hämmer unter dem Markennamen „PARX“ selbst zu fertigen.
Der Wandel zur Maschinenfabrik währte nicht lange. Eine weitere Zäsur brachte der 1. Weltkrieg und die folgende französische Besatzungszeit. Kronberg gehörte zum „Brückenkopf Mainz“ und so war es außerordentlich schwer, Produkte in das unbesetzte Deutschland auszuführen. Der Betrieb litt so sehr unter der politischen Situation, dass sich Johann Kunz entschloss, den Betrieb 1923 nach Osterode im Harz zu verlegen, das unbesetzt war. Er zog mit 23 Güterwaggons in die Fabrik Marienthal um, um den Maschinenbau dort weiter zu führen. 1926 wurde jedoch der Westharztalsperrenentwurf aufgestellt und so musste die Fabrik Marienthal der Sösetalsperre weichen. Da sich die Grenzen wieder geöffnet wurden und sich die politischen Verhältnisse wieder gebessert hatten, zog die Firma Kunz 1926 wieder zurück nach Kronberg. Das ganze Unterfangen verschlang einen großen Teil des Firmenvermögens und so nahm Johann Kunz seine beiden Söhne Hans und Walter in die Firma auf, um den Neuanfang stemmen zu können. Seit jenem Jahr firmiert das Unternehmern unter „Johann Kunz Söhne“. 1927 wurde in der Firma Johann Kunz Söhne der Automobilhandel ins Leben gerufen und eine Fahrschule sowie eine Tankstelle eröffnet. Seit dem vertrat die Familie Kunz die Firma Opel in Kronberg. Am 1. April 1934 übergab Johann Kunz das Unternehmen an seine Söhne Hans und Walter, die das Unternehmen unter sich aufteilten. Der ältere Sohn Hans Kunz übernahm das Automobilgeschäft und gründete die Firma Hans Kunz Automobile, den älteren Kronberger auch als „Opel-Kunz“ bekannt. 1939 zog dieser mit seinem Geschäft in die Frankfurter Straße 55.
Walter Kunz hingegen führte den Maschinenbau der Firma Johann Kunz Söhne weiter. Im Zweiten Weltkrieg war er aktives Mitglied der Kronberger Feuerwehr, deren Einsätze ihn in zerstörte Städte im Umkreis von bis zu 200 Kilometern führten. Dieser erschütternde Anblick inspirierte ihn dazu, Maschinenanlagen für die Trümmerverwertung zu konstruieren. Neben einer Ziegelputzmaschine entwickelte er ein Verfahren, bei dem Trümmerschutt in einem Ofen gesintert wurde, um daraus Betonzuschlag zu gewinnen.
Die Schutzrechte an diesem Verfahren wurden an die Lurgi AG verkauft, welche es in die mit der Stadt Frankfurt am Main, der Philipp Holzmann AG und Wayss & Freytag AG gemeinsam gegründete Trümmerverwertungsgesellschaft GmbH (TVG) einbrachte. Zu diesem Zweck errichtete die Lurgi AG für die TVG am Riederwald eine solche Anlage zur Behandlung des Frankfurter Trümmerschutts. Die daraus gewonnen TVG-Steine aus Ziegelsplittbeton ermöglichten einen Großteil des Wiederaufbaus Frankfurts.
Nach 1945 nahm die Firma Johann Kunz Söhne den Maschinenbau auf und entwickelte neue Maschinentypen wie Treibhämmer und Nietmaschinen. Sehr bald wurden die Räumlichkeiten in der Hartmutstraße zu klein, so dass die Firma Kunz erneut in ein neues Werk umsiedeln wollte, an das sie – da es einen Mangel an Graugusskapazitäten gab – eine Eisengießerei angliedern wollte.
So wurde 1952 ein 13.000 Quadratmeter großes Gelände am Schanzenfeld von der Stadt Kronberg gekauft und eine Gießerei errichtet, die schon am 31. Januar 1953 den ersten Guss lieferte. Damit begründete die Firma Johann Kunz Söhne das Gewerbegebiet zwischen Auernberg und Frankfurter Straße im Süden von Kronberg, der später noch weitere Firmen folgten. Bestand anfangs noch die Hoffnung, dass ein zweiter Kupolofen mit einer größeren Leistung zum Schmelzen des Eisens in Betrieb genommen werden sollte, so wandelte sich die technische und wirtschaftliche Entwicklung, woraufhin schon 1962 der Gießereibetrieb wieder eingestellt wurde, weil er nicht mehr rentabel war. In jenem Jahr siedelte auch der Maschinenbau komplett in das Werk in der Westerbachstraße um und die Belegschaft wuchs auf 50 Beschäftigte. Damals war die Firma Johann Kunz Söhne das größte Industrieunternehmen in Kronberg.
In den Jahren ab 1950 wandelte sich die Produktpalette der Maschinenfabrik: Die Produktionsweisen der Kunden hatten sich geändert und die Nachfrage nach Federhämmer wurden immer geringer, jedoch wurde eine Spitzenstellung im Markt im In- und Ausland durch die Herstellung von Aushau- und Kreisscheren erreicht.
Als der Enkel des Firmengründers, Dieter Kunz, 1968 in das Unternehmen eintrat und dessen Leitung übernahm, wurden zusätzlich Umform- und Bördelmaschinen für die Blechbearbeitung gefertigt, mit denen auch heute noch, beispielsweise Kochtöpfe oder Bierfässer, hergestellt werden. Eine Spezialität der Maschinenfabrik Kunz waren jedoch Coilverpackungsmaschinen, mit denen aufgerollte Bleche geschützt werden konnten. Nahezu jedes inländische und viele ausländischen Stahlwerke wurden damit ausgerüstet.
Ab den 1980er-Jahren wurde die Fertigung von Maschinen sukzessive an fremde Unternehmen vergeben. Die ehemaligen Werkshallen wurden immer weiter zu einem Büro- und Einkaufszentrum umgewandelt und schlussendlich entstand daraus das am 1. September 1990 offiziell eingeweihte Westerbach-Center auf dem ehemaligen Gießereigelände.
Jedoch ist die wirtschaftliche Entwicklung auch an der Firma Johann Kunz Söhne nicht spurlos vorüber gegangen. Johann Kunz‘ Enkel Hartmut Kunz hatte von seinem Vater Hans die Firma „Opel-Kunz“ übernommen. Im Jahre 1997 verkaufte er den Automobilbetrieb an die Unternehmensgruppe Georg von Opel und 2012 wurde das Westerbach-Center von Dieter Kunz an den Klinikbetreiber Werner J. Wilhelm Wicker verkauft. Die Spuren, die die Firma Johann Kunz Söhne hinterlässt, verbleiben aber. Noch heute sind Taunus Rodel erhalten und werden von einigen Kronbergern im Winter immer noch genutzt. Weltweit sind noch immer die Werkzeugmaschinen der Firma im Einsatz, was von deren Qualität zeugt. Es vergeht kaum ein Monat, in dem nicht eine archivarische Anfrage zu einer Maschine gestellt wird und speziell das Interesse an den PARX-Federhämmern ist wieder erwacht. Unter Kunst- und Damastmesserschmieden sind diese Hämmer wegen ihrer feinfühligen Regulierbarkeit gesuchte Maschinen. In Kronberg besitzen die Schmieden Krieger und Scheller ebenfalls noch solche Federhämmer.