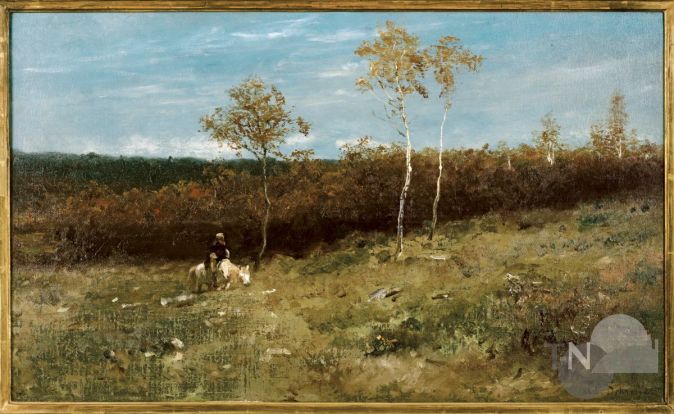Kronberg (war) – Im Metropolitan Museum in New York hängt er und bei Sotheby kommt er noch heute immer wieder bei Auktionen unter den Hammer. Gemeint ist Adolf Schreyer oder genauer gesagt, eines seiner Bilder mit Motiven aus dem Orient oder Nordafrika. Vor 125 Jahren, am 29. Juli 1899, ist der im Jahr 1828 in Frankfurt am Main geborene Künstler, der auch der Kronberger Malerkolonie zugerechnet wird, in der Burgstadt verstorben. Während Anton Burger als „Malerkönig“ von Kronberg als „Platzhirsch“ vor Ort agierte, so kann Adolf Schreyer sicherlich als der auf dem internationalen Kunstparkett renommierteste Kunstmaler unter all seinen Kollegen der hiesigen Malergilde angesehen werden. Sein Rezept war es, sich auf eine relativ enge Motivauswahl zu konzentrieren, um diese immer wieder in unterschiedlichen Variationen auf die Leinwand zu bannen und so zu seiner unverwechselbaren „Marke“ zu machen. Dazu gehörten Pferde, oft in Verbindung mit verwegenen Soldaten und orientalischen Kriegern in Kampfszenen. Manch zeitgenössischer Kunstkritiker bemängelte, dass sich in seinen Bildern die Motive allzu oft wiederholen und ähneln würden, so dass in seinem Malstil keine Entwicklung erkennbar sei. Andere sehen Schreyer hingegen als frühen Wegbereiter des Impressionismus in Deutschland. Letztlich gab dem Künstler der Erfolg recht, konsequent bei seiner „Linie“ zu bleiben, zumindest finanziell gesehen. Motive aus Kronberg und Umgebung lassen sich dagegen nur sehr selten auf seinen Bildern finden. Gerade einmal 15-jährig besuchte Schreyer das Städelsche Kunstinstitut. Hier war er Schüler von Jakob Becker, bei dem zu dieser Zeit eine Reihe von Malern der späteren Kronberger Malerkolonie, wie Anton Burger, ebenfalls in die Lehre gingen. In dem Begleitbuch, das anlässlich einer Ausstellung in der Rezeptur zum 100. Todestag des Künstlers im Jahr 1999 erschien, erwähnt Monika Öchsner-Pischel, dass Schreyer von Beginn an den Wunsch geäußert habe, „Thiermaler“ zu werden. Insbesondere Pferde hatten es dem Kunstschüler angetan. Dass er das Reiten lernte war eine logische Folge. Weitere Studienaufenthalte verbrachte er zudem in Düsseldorf, Stuttgart und München. Öchsner-Pischel formuliert weiter: „Seinen Lebensunterhalt finanzierte er anfangs überwiegend durch Porträts sowie Hunde- und Pferdedarstellungen für reiche Auftraggeber.“ Als sehr viel Militär wegen der Septemberunruhen 1848 in Frankfurt stationiert war, kam der junge Maler mit Soldaten, darunter waren österreichische Kavalleristen samt ihren Pferden, in Kontakt. Wohl über diese Schiene nahm er mit der österreichischen Armee als Beobachter am Krimfeldzug im Jahr 1854 teil. So gelangte er nach Ungarn, die Walachei, Galizien, Südrussland und über die Türkei bis nach Syrien, um in seinen Skizzenbüchern seine Eindrücke festzuhalten, aus denen er noch Jahre später stimmungsvolle Gemälde bis hin zu fiktiven Schlachtenszenerien im Atelier entstehen ließ, die den Geschmack seines kaufkräftigen Käuferkreises genau trafen. „Mit dem französischen ‚Artillerie-Angriff in der Schlacht bei Traktir auf der Krim‘ am 16. August 1855 gewann er 1865 in Paris die Goldmedaille und wurde als großer Schlachtenmaler gefeiert. Das Gemälde wurde von der französischen Regierung für das Palais du Luxembourg erworben.“, ergänzt Monika Öchsner-Pischel. Dort hatte er sich im Jahr 1862 mit seiner Frau Johanna Maria, die er 1859 geheiratet hatte, niedergelassen. Bald galt er fast mehr als französischer denn als deutscher Künstler. Da in Frankreich zu dieser Zeit alles Orientalische „en vogue“ war, fanden Schreyers Bilderthemen aus dem arabo-muslimischen Kulturraum rasch reißenden Absatz und gewannen immer wieder Preise bei Ausstellungen. Kaiser Napoleon III. kaufte schließlich sein Bild „Kosakenpferde im Schnee.“ Eine bessere Werbung konnte es für Bilder „made by Schreyer“ nicht geben. Nebenbei verkaufte er für seinen Kollegen Anton Burger einige Bilder in Frankreichs Hauptstadt. Ähnlich gut lief es für ihn auf dem belgischen und vor allem auf dem US-amerikanischen Kunstmarkt. „Es war dort geradezu Mode, daß in jedem Salon ein Schreyer hängen musste.“, so Öchsner-Pischel. In New York vertrieben feste Kunsthändler seine Werke zu Höchstpreisen. Zahlreiche dieser Verkäufe sind in acht seiner Skizzenbücher dokumentiert, die heute im Städel hinterlegt sind. Schreyer selbst hat hier alleine über 600 Bilder aufgelistet, die er im Laufe der Jahrzehnte an Privatleute, Galerien und Museen veräußert hat. Während in Westeuropa die Industrialisierung das Leben der meisten Menschen mehr und mehr durchtaktete, verhieß der Orient sowie Afrika noch Abenteuer und in gewisser Weise Freiheit von Zwängen. Wer es sich leisten konnte, ging auf Großwildjagd oder reiste per Bahn und Schiff in exotische Länder, um dort das ursprüngliche Leben mit vermeintlich un- oder kaum „zivilisierten“ Menschen für eine gewisse Zeit zu teilen. Danach wurde aber wieder gerne in den vertrauten und scheinbar überlegenen europäischen Kulturkreis zurückgekehrt. Nicht vergessen werden darf auch, dass Frankreich zu dieser Zeit gerade im Begriff war, sich insbesondere in Nord- und Zentralafrika ein großes Kolonialreich anzueignen. Schon aus diesem Grund bestand ein enormes Interesse an diesen Ländern und ihren Bewohnern, die Schreyer in seinen Bildern beschrieb. Während heute rückblickend diese oft mit extremer Unterdrückung und Gewalt einhergehende Kolonialisierung sehr kritisch bis negativ gesehen wird, waren im 19. Jahrhundert hingegen viele europäische Länder inklusive dem Deutschem Reich geradezu bestrebt, sich möglichst große Kolonialgebiete einzuverleiben, dabei die jeweilige Bevölkerung weitgehend hinter sich wissend.
Neue Inspirationen holte sich Schreyer von Paris aus bei Reisen nach Nordafrika. Jetzt zu großem Reichtum gelangt, wohnte er in einem hochherrschaftlichen Appartement am vornehmen Place Vendôme und genoss den Großstadttrubel in vollen Zügen. Das „süße“ Pariser Leben fand jedoch im Jahr 1870 mit Ausbruch des deutsch-französischen Kriegs ein jähes Ende. Nun zog das Ehepaar endgültig nach Kronberg, in dem es sich zuvor gelegentlich in den Sommermonaten aufgehalten und bei Gärtner Müller in der Doppesstraße 17 gewohnt hatte. Bis das Ehepaar in das im Jahr 1872 erworbene Haus in der Hainstrasse 11 einziehen konnte, das um 1960 abgerissen wurde, waren beide Logiergäste im Hotel Frankfurter Hof. Nach dem raschen Sieg der Deutschen über die Franzosen machten es sich Schreyers zur Gewohnheit, den Sommer über in Kronberg zu wohnen und den Winter in Paris zu verbringen. Im Jahr 1880 ernannte der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin Schreyer zum Hofmaler und zeichnete ihn mit dem Professorentitel aus. 1895 wurde er schließlich zum Ehrenbürger der Burgstadt ernannt, aber laut Protokollbuch nicht wegen seiner Verdienste um die Kunst, sondern „weil sich derselbe für das Feuerlöschwesen sowie für die Armen verdient gemacht hat.“ Ergänzend dazu heißt es in der Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr in Kronberg aus dem Jahr 1949: „Wie das Protokoll weiter berichtet, war es besonders ein Mann, welcher der Wehr immer hilfreich zur Seite stand und der dann in Anbetracht seiner wohlwollenden Gesinnung im Jahr 1886 zum Ehrenmitglied ernannt wurde: es war dies der am 29. Juli 1899 verstorbene Maler Prof. Adolf Schreyer. Wann immer es galt eine Anschaffung zu machen, hatte er eine „offene Hand.“ Ab dem Jahr 1896 lebten die Schreyers dann durchweg in Kronberg. Hier verstarb der viel geehrte Künstler am 29. Juli 1899. Neun Feuerwehrmänner trugen seinen Sarg zum Friedhof. Noch im selben Jahr wurde in der Berliner Nationalgalerie eine große Gedächtnisausstellung mit Bildern von Schreyer gezeigt.