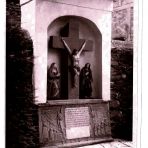Königstein (kw) – Auf dem ehemaligen Friedhof der Katholischen Kirche St. Martin in der Kirchstraße stand bis vor kurzer Zeit an der nordseitigen Kirchhofsmauer eine Kreuzigungsgruppe – ein ikonografischer Topos (neuzeitlich), der aus einem Holz-Kruzifix an einem Rotsandsteinkreuz, zwei Basalt-Assistenzfiguren, Maria und Johannes sowie einem gemauerten Unterbau bestand.
An dessen Vorderseite war eine Gedenkplatte aus Rotsandstein angebracht. In dessen Mitte befand sich eine weiß angemalte Texttafel, links flankiert die Darstellung eines Vaters mit seinen Söhnen und rechts die der Mutter mit ihren Töchtern, erhaben dargestellt, die Tafel. Über deren Köpfen sind mit einem Kreuz die Personen markiert, die zur Zeit der Aufstellung bereits verstorben waren.
Der Text auf der Inschrifttafel lautet:
„ZU DER EHRE GOTTES HAT HANS JACOB BENDERS VND ELISABETHA VERSTORBENER BEIDER EHELEUTHEN DOCHTERMAN JOHANNES RIED VND ANNA MARIA AUF DER MUTTER LETZTENS BEGERN BEY DERASELBEN VND IHRER NACHKOMMENDEN AHN HIESGEN ORTT HABEN DEN BEGRAEBNUS DIESES AUFFRICHTEN LASEN ANNO 1664 “
Diese Grabplatte ist für Königstein einmalig, ein Juwel in ihrer zeitgenössischen Darstellung des 17. Jahrhunderts und der Hervorhebung einer angesehenen Persönlichkeit mit ihrer Familie, die hier auch nach 360 Jahren immer noch präsent ist.
Der älteste Begräbnisplatz in Königstein, der Patershof, befand sich, wie auch eine kleine Kirche, in der Altstadt unterhalb der Burg und wird 1645 erstmals im Pfarrarchiv genannt. Selbstverständlich geht seine Belegung auf die Zeit der ersten Besiedlung in der Altstadt zurück.
Geistliche und hohe Persönlichkeiten der Stadt wurden aber schon seit ca. dem 14. Jahrhundert in der Kirche St. Bartholomäus (die in etwa auf dem Areal der heutigen Kirche St. Marien lag) bestattet. Davon zeugen heute noch einige Epitaphien, die später in und um die Kirche aufgestellt wurden. Nachdem aber die katholische Kirche in der Altstadt 1681 abgetragen und als Baumaterial für den Bau des Kapuzinerklosters (1682) verwendet wurde, fanden dort auch keine Bestattungen mehr statt.
Der Hauptfriedhof beider Konfessionen war nun um die Pfarrkirche St. Bartholomäus herum und hauptsächlich auf dem südlichen Areal bis ins 19. Jahrhundert. Durch Hinzukauf eines neben der Kirche liegenden Ackers an der Limburger Straße konnte der Friedhof 1838 erweitert und mit einer umfassenden Mauer bis zur Klosterstraße umgeben werden. Als sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts entlang der Limburger Straße und Ölmühlweg die Stadt vergrößerte, wurde der Friedhof zu klein und Kirche und Friedhof befanden sich nun im Zentrum der Stadt. Doch nachdem die Herzogliche Nassauische Regierung die Obhut der Friedhöfe den Kirchengemeinden entzogen hatte und die Sorge dann der Stadtverwaltung oblag, wurde eine erneute Erweiterung 1876 abgewiesen.
Gefordert wurde ein Friedhof außerhalb der Stadt, so dass 1877 das Gelände am „Roten Kreuz“ (Limburger Straße) erworben und ein neuer Friedhof hergerichtet wurde. Die erste Bestattung auf dem neuen Friedhof fand am 4. Juli 1878 statt. Der alte Friedhof in der Kirchstraße wurde 1878 geschlossen, jedoch die Grabsteine blieben weiterhin stehen und wurden von den Angehörigen gepflegt.
Anlässlich der Errichtung des Kriegerdenkmals Germania an der Bleichstraße (heute Herzog-Adolph-Straße) am 22. September 1878 berichtet der Heimathistoriker Georg Piepenbring 1898: „(...) wurde die halbe Länge der Kirchhofsmauer abgerissen und am Kriegerdenkmal die Mauer aufgeführt. Es wäre doch viel einfacher gewesen, die Mauersteine dazu fahren zu lassen und die Kirchhofsmauer, welche zum Schutz des Friedhofs stand, ruhig stehen zu lassen.“ Auf der folgenden Fastnacht 1899 wurde dieser Streich mit den Worten „die Kirchhaus Mauer abgerissen und über die Chaussee niwergeschmisse“ verwitzt.
1891 wurde der ganze alte Baumbestand auf dem Friedhof abgeholzt und neu mit Kugelakazien bepflanzt. 1927 ließ die Kirchengemeinde das ganze Areal einebnen. Jedoch wurden die Grabsteine, deren Erhalt die Angehörigen wünschten, nach der Mauer zur Klosterstraße hin neu aufgerichtet. Bei dieser Aktion wurde auch die Kreuzigungsgruppe mit Unterbau und Texttafel versetzt. Wo sich aber die Grablege in situ ehemals befand, ist nicht mehr auszumachen.
Auf dem Stich von C. Petsch 1792/3 sieht man die Kreuze auf der südlichen Seite der Kirche, wo die Erstbelegungen stattfanden. Für eine Bestattung in der Kirche gibt es keine Hinweise, solche lässt auch der Inhalt der Schrifttafel nicht zu.
Auch ob sich das Grabdenkmal bereits 1664 in der heutigen Zusammensetzung – Kruzifix Holz, Maria und Johannes Basalt, Schrifttafel Rotsandstein – schon befand, ist aus stilistischen Gründen sowie der unterschiedlichen Gesteinsarten sehr fraglich. Es vermittelt mehr den Eindruck, dass hier – zumindest aus der Zeit der Auflösung 1927 – eine Zusammenstellung aus noch vorhandenen Grab-Skulpturen vorgenommen wurde. Es könnten aber auch Maria und Johannes noch aus der alten Kirche in der Altstadt von der Auflösung 1681, aber auch aus der Kugelherrnkirche 1540 hierher gekommen sein.
Hans Jacob und Elisabeth Bender
Doch wer waren die namentlich genannten Personen Hans Jacob Bender und seine Ehefrau Elisabeth, die mit einer solch großartigen Grabplatte von ihrer Tochter Anna Maria und dem Schwiegersohn Johannes Ried gewürdigt wurden – ein Privileg, das nur Adligen, hohen Beamten und wohlhabenden Bürgern eingeräumt wurde. Hans (Johann) Jacob Bender war ein reicher und angesehener Bürger in Königstein.
Sein Name erscheint zum ersten Mal in einem „Muster Register, zum Ausschuß under daß Fänlein Königstein den 28ten Aprilis Anno 1607, gemustert worden unter der Regierung von Erzbischof und Churfürst Johann Schweickhardten“, in welchem er mit „Schlachtschwerdt und Rüstung (d.h. mit Panzer oder Panzerärmel) an 1. Stelle angeführt wird.
Kurmainz hatte in diesem Jahr in seinem Territorium für Kriegszeiten eine militärische Landeseinteilung festgelegt. Jede Grafschaft mußte dem Umfang entsprechend ein „Fänlein“ stellen, eine Gruppe aus Landsknechten, Pikenieren, Hellebardieren, Feldwebel, Trommler etc. Diesem sogenannten „Haufen unter einem Fänlein“ gehörten aus Königstein mit 18 umliegenden Ortschaften 282 Männer an. Die Ausrüstung mussten alle selbst stellen und sich einer Musterung unterziehen.
Hans Jacob Bender war in 1. Ehe mit Sibylle nn. verheiratet und hatte seine Behausung am Burgberg. Dieses Haus war vom Wächtergeld befreit, das heißt, der Inhaber stand in herrschaftlich Mainzischen Diensten. 1611 kaufte er das Gasthaus „Zum König“, auch „Zu den Drei Königen“ genannt (Hintere Schloßgasse), das führende und renommierteste Gasthaus am Platze. Viele Amtspersonen wie auch Angehörige der Herrschaft übernachteten hier am Fuße des Schlosses. Im gleichen Jahr trat er als Zeuge in einem „Todtschlagsvertrag“ auf.
1612 nimmt er zusammen mit seiner Ehefrau einen Grundstückstausch von zwei Wiesen an der Neuenhainer Pfarrwiese vor und verkauft sein Kelkheimer Gut für 460 Gulden. Im gleichen Jahr verkauft er auch seine Behausung in der Vorburg für 30 Gulden. 1627 tritt er als „Wirt zum König“ in einem Prozess gegen Jacob Walter, einen Bierbrauer, auf. Es muss angenommen werden, dass Sybille Bender 1626 verstarb, Hans Jacob Bender um 1633. In zweiter Ehe war er mit Elisabeth nn. verheiratet, geb. um 1591, verstorben am 17. März 1655.
Tochter Anna Maria heiratet am 14. Oktober 1641 in Königstein Johann Ried, Sohn des Henrici Riedens von der Amöneburg. Als Zeugen werden bei ihrer Hochzeit hohe Persönlichkeiten genannt, u.a. Johann Dietrich von Rosenbach, kurfürstlicher Mainzischer Rat und Oberamtmann der Grafschaft Königstein (Epitaph in der Kirche). Die zweite Tochter, Anna Margaretha, heiratet am 15. Juni 1654 Johann Weppener von der Amöneburg, Sohn des Hospitalmeisters undt Trappeney Verwalters des löblichen teutschen Ritterordens zu Marpurg.
Restaurierung ab 1954
Pfarrer Becker berichtete, dass 1954 eine Restaurierung dieses Grabdenkmals von Herrn Prof. Paul Kratz vorgenommen wurde, was in den 80iger Jahren im Auftrag der Familien Bender von dem Restaurator Herrn Kurt Knüttel wiederholt wurde. Dabei wurden die beschädigten Darstellungen wieder aufgearbeitet.
Doch durch Witterungseinflüsse hat nicht nur die Kreuzigungsgruppe, sondern auch der barocke Unterbau sehr gelitten, der direkt ohne Sockelschutz im Erdreich stand.
2016 erging eine Anfrage von der Familie Bender/Reibert an die damalige Vorsitzende des Vereins Denkmalpflege-Königstein e.V., die Angelegenheit der Restaurierung dieses Grabdenkmals bezüglich Technik und Abrechnung zu übernehmen. Ein Angebot zur Restaurierung wurde von dem Diplom-Restaurator Matthias Steyer aus Niedernhausen angefordert. Übernommen wurde das Projekt 2018 von der neuen Vorsitzenden Ellengard Jung, die es nach langen Verhandlungen mit Vorstand und Restaurator zu einem sehr zufriedenstellendem Ergebnis brachte.
Die Finanzierung erfolgte durch Spenden der Familien der Bender-Nachkommen, der Denkmalbehörde Wiesbaden, Denkmalpflege-Königstein e.V. sowie dem Katholischen Frauenverein.
Die Arbeiten an der Grabplatte waren äußerst zeitintensiv – zum Beispiel Entsalzungen –, ehemalige Farbstrukturen wurden wieder entdeckt und konserviert, das Weiß der angemalten Tafel entfernt, die nun wieder im originalen Rotsandstein erstrahlt. Eine Wiederherstellung und Aufbau der beschädigten Steinstrukturen werden vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen nicht befürwortet, der Ist-Zustand wird nur noch konserviert.
Um das Zeugnis der Vergangenheit nicht wieder der Bodennässe und weiteren Zerstörung auszusetzen, wurde eine Anbringung an der rückseitigen Chorwand der Kirche St. Marien in Abstimmung mit der Kirche ausgewählt, wo sie jetzt in Augenhöhe und mit einem Schutzdach vor der Witterung geschütztsicher für die Zukunft angebracht wurde.
Ellengard Jung
Vorsitzende Denkmalpflege-Königstein e.V.