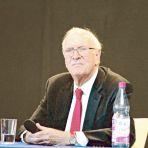Kronberg (mg) – Wenn man in Kronberg in den Bus steigt, um in Richtung Krzyzowa – ein kleines Zweihundertseelendorf rund 60 Kilometer entfernt von Breslau in Polen – zu fahren, macht man sich gleichzeitig auf den Weg in oder vielmehr durch die gesamtdeutschen Bundesländer Thüringen und Sachsen, die man zwangsläufig passiert. Was geht einem politisch interessierten und sich der Demokratie verpflichtet fühlenden Menschen während der Fahrt womöglich unter anderem durch den Kopf? Im zurückliegenden Monat fanden drei Landtagswahlen statt – in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und in Brandenburg. Bei jeder dieser Wahlen erzielte die vom Verfassungsschutz der Bundesrepublik Deutschland in Teilen als rechtsextrem eingestufte Alternative für Deutschland (AfD) rund 30 Prozent der Wählerstimmen, wurde in Thüringen stärkste Fraktion. Was sich vergangene Woche, am 26. September, von den Bürgerinnen und Bürgern im neugewählten Thüringer Landtag abspielte, erinnerte zudem gleichzeitig nicht zu Unrecht an die politischen Realitäten und Wirrungen der sogenannten „Weimarer Republik“. Die Zeit in der Geschichte Deutschlands, die dem antidemokratischen und weltkriegstreibenden Unrechtsregime der Nationalsozialisten im 20. Jahrhundert historisch vorgeschaltet war. Der vom Verfassungsschutz der Bundesrepublik Deutschland – auch „Frühwarnsystem der Demokratie“ zum Erhalt der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Deutschlands genannt – wie schon geschrieben als rechtsextremistisch eingestufte Verdachtsfall AfD blockierte in Thüringen die Wahl eines Landtagspräsidenten. Der Thüringer Landtag scheiterte beim ersten Versuch, sich zu konstituieren. Nach vielen Unterbrechungen und ansatzweise tumultartigen Szenen – hervorgerufen durch den undemokratischen Sitzungsboykott des Alterspräsidenten (AfD) des thüringischen Landtags – wurde seitens der demokratischen Kräfte im Landesparlament das Landesverfassungsgericht angerufen. Die Justiz sicherte am vergangenen Samstag zumindest noch die Demokratie mit ihrem Urteil, setzte dem willkürlich handelnden Alterspräsidenten der AfD klare Grenzen und gab ihm Maßgaben vor. Wenn man ein Stück weit im Geschichtsunterricht aufpasste, liegt die Assoziation zur politischen Atmosphäre in der „Weimarer Republik“ vor 100 Jahren ohne Umschweife klar und deutlich auf der Hand. Die Missachtung demokratischer Spielregeln der AfD im Landtag von Thüringen ist ein Mosaikstein aller noch vorhandenen Erinnerungen von Zeitzeugen während der Nazizeit. Es wäre nicht allzu vermessen, wenn man bereits an dieser Stelle formuliert, dass die Demokratie auch im Jahr 2024 hierzulande durch das Geschehen in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt erneut Schaden genommen hat.
30 Jahre Kreisau-AG
Während die eine oder der andere sich vergangene Woche an folgenschwere Wirrungen und Irrungen während der „Weimarer Republik“ erinnert sah, kamen zur selben Zeit im oben genannten polnischen Krzyzowa viele junge Menschen aus einigen Teilen Europas im ehemaligen Kreisau zusammen, um eben über Demokratie, Demokratiegefährdung und zumindest mögliche Lehren aus der Vergangenheit zu sprechen und zu diskutieren – alles unter einem europäischen „Gedankengutdach“ vereint, das der Verständigung europäischer junger Menschen dienen soll. So soll bereits früh etwaigen Missverständnissen zwischen den Nationen vorgebeugt werden, die mitunter im Laufe der Zeit zu Spannungen und vielleicht auch Kriegen führen können. Unter den jungen Europäern aus Polen, Tschechien, Frankreich und Spanien sind in diesem Jahr auch erneut Schülerinnen und Schüler der Kronberger Altkönigschule (AKS) in Krzyzowa. Die bislang teilnehmenden jungen Menschen aus Weißrussland fehlen wegen des aktuell völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Im Jahr 2024 war es eine Jubiläumsfahrt für die deutsche Schülerschaft, denn die Kreisau-AG der AKS besteht nunmehr seit drei Dekaden. Wer, wenn nicht junge Menschen mit demokratischem Bewusstsein, könnte der Zukunft und dem Erhalt der Demokratie noch Hoffnung verschaffen? Nun sind es gleichzeitig viele junge Erwachsene gewesen, die überdurchschnittlich häufig die AfD bei den oben genannten drei Landtagswahlen wählten. Wo setzt man an? Wie erreicht man auch junge Menschen, die nicht einer Bildungsschicht entspringen, die automatisch demokratische und humanistische Werte vermittelt? Wer spricht mit Schülerinnen und Schülern, die nicht eine derart gesellschaftspolitisch engagierte Schule wie die AKS besuchen?
Kreisauer Kreis
Die historische Bedeutung Kreisaus beginnt in den Jahren 1942 und 1943 während des Zweiten Weltkriegs. In dieser Zeit traf sich die Widerstandsbewegung gegen das Naziregime um die Person Helmuth James von Moltke (Kreisauer Kreis) im kleinen, damals noch zu Deutschland gehörenden Dorf in Niederschlesien.
Getarnt als Familienfeiern wurden während der drei Begegnungen der ungefähr 20 Demokraten Pläne für das Gestalten eines demokratischen Rechtsstaats nach dem Ende der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft angedacht und geschmiedet. Es kam anders, als es die Pläne vorsahen – zumindest für die Betroffenen. Das am 20. Juli 1944 missglückte Attentat auf Adolf Hitler durch Claus Schenk von Stauffenberg lenkte die Aufmerksamkeit durch Mitvorbereiter und Unterstützer auch auf die Mitglieder des Kreisauer Kreises. Die „Geheime Staatspolizei (Gestapo)“ wurde aktiv und verhaftete die „Kreisauer“. Der 23. Januar im Jahr 1945 war dann der letzte Tag Helmuth James von Moltkes. Zusammen mit neun anderen Männern wurde er im Gefängnis von Berlin-Tegel hingerichtet. Knapp sieben Monate später endete der Krieg. Sieben Jahre alt war Helmuth Caspar von Moltke, als sein Vater ermordet wurde. Am 13. September 2024 war er einmal mehr zum Festakt des 30-jährigen Bestehens der Kreisau-AG zu Gast in der Altkönigschule in der Le-Lavandou-Straße 4.
Feierstunde
Neben den Vertretern des Lions Club Kronberg, der das Kreisau-Projekt seit vielen Jahren finanziell stark unterstützt, waren auch Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Kronberg, des Hochtaunuskreises und der Sanddorf-Stiftung aus Regensburg vor Ort, die sich ebenfalls für das Konzept der Völkerverständigung seit langem engagieren. Seitens der Stadt Kronberg war neben Stadtarchivarin Susanna Kauffels auch Stadträtin Ute Neumann vor Ort und bedankte sich in ihrem Wortbeitrag voller Überzeugung bei den Jugendlichen für deren Engagement. Sie betonte, dass es gerade für junge Menschen eine Herausforderung sei, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Die Nachbarkommune Steinbach war mit Lars Knobloch, dem dortigen Ersten Stadtrat, vertreten. Knobloch beschrieb eindrücklich in einer bemerkenswerten und sehr persönlichen Rede vor vielen jungen Menschen, die ein geteiltes Deutschland nicht mehr kennenlernten, dass seine Eltern gleich zwei Diktaturen erlebten; zum einen den NS-Staat und zum anderen bis zu ihrer Flucht in den 1960ern die ehemalige DDR. Beide Elternteile berichteten ihrem Sohn viel über Repressalien, denen sie ausgesetzt waren: „Mein Vater sagte einmal zu mir, dass es in einer Diktatur verschiedene Protagonisten gibt. Es gibt Überzeugungstäter voll auf Parteilinie, Mitläufer, Opportunisten, Menschen, die sich ins Private zurückziehen, Menschen, die wie wir keine Hoffnung haben und fliehen. Und es gibt die Menschen, die Widerstand leisten und etwas verändern wollen.“ Knobloch mahnte zur selben Zeit zu schnelle wertende Urteile an, da man selbst nicht wissen könne, wie man sich verhalten hätte. Eines stehe jedoch fest: „Es gehört unheimlich viel Mut dazu, in einer Diktatur Widerstand zu leisten. Diesen Mut aufzubringen, bei Enttarnung oder Verrat den Widerstand gegen den totalitären Staat mit Gefängnis oder gar mit dem Leben bezahlen zu müssen“. Steinbachs Erster Stadtrat ergänzte, dass es nicht selbstverständlich sei, in einer Demokratie leben zu dürfen, es aber womöglich häufig viel zu selbstverständlich gesehen werde: „Wie stark eine Demokratie ist, hängt immer auch davon ab, wie viele Menschen bereit sind, sich für sie einzusetzen, sich zu beteiligen und sie zu verteidigen“.
Helmuth Caspar von Moltke
Im Anschluss an viele einleitende Reden vor ihm ergriff der im Jahr 1937 in Bonn geborene älteste Sohn des Widerstandskämpfers von Moltke das Wort, inmitten des Kronberger Schulgebäudes. In ruhigen, klaren Formulierungen mit bewusst gesetzten Pausen zum Nachdenken und Nachfühlen der doch zum Großteil dramatischen Inhalte, die er transportierte, rief Helmuth Caspar von Moltke eine nachdenkliche und gleichzeitig Mitgefühl erzeugende Atmosphäre beim größtenteils doch jungen Publikum hervor. Er beschrieb, dass die Abgeschiedenheit des „winzigen Dorfs“ prädestiniert für die Vorbereitungen der Widerständler gewesen sei. Das Dokument mit den Plänen für ein neues demokratisches Deutschland wurde unter anderem auch dort im Schloss von Freya von Moltke, seiner Mutter, versteckt. Als Jurist fiel es dem noch lebenden Nachwuchs der von Moltkes während der Feierstunde nicht schwer, dem Kronberger Publikum die Begebenheiten sachlich zu beschreiben. Dennoch blitzte auch sein bewegtes Gemüt im fortgeschrittenen Alter doch häufiger auf, seine Blicke verrieten ein ums andere Mal die zwar mittlerweile verarbeitete, dennoch nach wie vor existente Traurigkeit über das Schicksal und den persönlich frühen Verlust seines Vaters, den er mehr aus Erzählungen kennenlernte als durch eigene Erfahrungen mit ihm. Ein Schicksal, das er gleichzeitig mit vielen Kindern dieser Zeit teilte und teilt. Die abwesenden Väter bestimmten häufig den emotionalen Alltag im Nachkriegsdeutschland. Und an vielen Orten der Welt nach Ende des Kriegs. Caspar von Moltke verlor neben der Vaterfigur auch die Heimat. Seine Mutter emigrierte mit ihm nach Südafrika, dort lebte seine Großmutter. Seine weitere akademische Ausbildung absolvierte er in Großbritannien. Beruflich waren fortan viele Länder dieser Welt sein Zuhause. „Kreisau verschwand für uns hinter dem ‚Eisernen Vorhang‘“, formulierte es von Moltke. Das blieb nach seinen Angaben mehr oder weniger, jenseits von ein paar Kontakten zu polnischen Oppositionellen, bis zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1990 so. Fortan fanden dort Verständigungen zwischen Frankreich, Polen und Deutschland statt, um die Geschehnisse des nunmehr bald 50 Jahre zurückliegenden Weltkriegs aufzuarbeiten.
Freya von Moltke
Nun fiel in der geschichtlichen Betrachtung gewiss häufig der Name Helmuth James von Moltke. So auch in den Bemerkungen während der Feierstunde. Nicht zuletzt durch die Biographinnen und Autorinnen Frauke Geyken und Sylke Tempel rückte gleichzeitig im Jahr 2011 auch seine Ehefrau und die Mutter von Helmuth Caspar – Freya von Moltke – spät, aber nicht zu spät, deutlich mehr ins Licht der Bedeutung. Sie war ebenso eine deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus wie ihr Ehemann, zugleich Schriftstellerin und Juristin. Und wie ihr Sohn Helmuth Caspar in der Aula der AKS mitteilte, der Mensch in seinem Leben, der eine sehr wichtige Rolle spielte: „Meine Mutter war eine ausgesprochen starke Persönlichkeit und spürte stets, was mir auf dem Herzen lag. Wenn sie den Eindruck hatte, dass Unrecht geschieht, engagierte sie sich tatkräftig. Ich habe ihr viel zu verdanken.“
Jugendbegegnungsstätte
Das Moltke-Schloss, das damals die Widerstandskämpfer beherbergte, steht nach wie vor im Ortszentrum des heutigen Krzyzowa und früheren Kreisau und dient seit dem Jahr 1998 als „Internationale Jugendbegegnungsstätte Kreisau“, die von der „Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung“ betrieben wird. Martin Fichert, Leitung des Fachbereichs II an der AKS, und Daniel Keiser sind Lehrer am Fachbereich Politik und Wirtschaft an der AKS und kennen das Gebäude bereits gut. Viele Fahrten unternahmen sie bis zu diesem Zeitpunkt mit jeweils anderen Schülerinnen und Schülern. Im Rahmen von Workshops, Vorträgen und Exkursionen setzen sich die Jugendlichen jedes Mal eine Woche lang mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus, mit der polnisch-deutschen Geschichte und dem Holocaust auseinander. Ein Besuch der Konzentrationslager-Gedenkstätte Groß-Rosen (polnisch Rogoznica) auf dem heutigen Staatsgebiet Polens steht meistens auch auf der Agenda des einwöchigen Besuchs. Politische Gefangene, Kriegsgefangene, Widerstandskämpfer und Menschen jüdischen Glaubens wurden dort während der Naziherrschaft unter extremen Bedingungen inhaftiert und zu Zwangsarbeit gezwungen. 125.000 Menschen erlebten das Martyrium und damit ihr persönliches Schicksal in Groß-Rosen, 40.000 davon starben vor Ort und Stelle. Im Rahmen des Aufenthalts finden im ehemaligen Schloss der von Moltkes gleichzeitig auch sogenannte „Länderabende“ statt, an denen die Jugendlichen aus den unterschiedlichen Ecken Europas unterhaltsam ihr Heimatland, ihre Schule und eigene kulturelle Besonderheiten vorstellen. „Es ist ein ganz besonderer Ort, auch für mich persönlich“, beschreibt Daniel Keiser seine und die Erfahrungen der Schülerschaft, die Kreisau bislang kennenlernte. „Es ist nicht nur ein Ort des Gedenkens, sondern auch ein Platz, an dem Geschichte lebendig wird“, ergänzt sein Kollege Martin Fichert. Es ginge stets darum, von der Vergangenheit zu lernen und durch das Erlernte die Gegenwart positiv im demokratischen Sinne mitzugestalten.
Diskurs
Wie man unter anderem versucht, zu lernen, bewiesen auch die Kronberger Schülerinnen Nika Ristic und Natalia Parlov. Während der Feierlichkeiten nahmen beide gemeinsam Platz auf der Bühne der Aula und moderierten ein Gespräch mit dem Zeitzeugen Helmuth Caspar von Moltke. Das Publikum wurde einbezogen. Jung und Alt beteiligte sich rege mit weiteren Fragen, die von europäischen Themen bis hin zum Thema Apartheid – das politische System der Rassentrennung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Südafrika – führten. Die beiden Moderatorinnen sprachen die aktuelle politische Situation in Deutschland an, fragten von Moltke, wie man mit der AfD umgehen solle. Sie fragten den Juristen nach der Möglichkeit eines Parteienverbots und gleichzeitig danach, woher die anscheinend deutlich existenten Wurzeln der Unzufriedenheit in diesem Wählerspektrum kämen. Von Moltke sollte Auskunft über persönliche Dinge geben, beispielsweise wie er aufgewachsen sei, wie das Schicksal seiner Familie sein eigenes Leben prägte und auch, wie er selbst die Zukunft der Demokratien weltweit einschätze. Von Moltke bemühte meist die globalen Zusammenhänge in seinen Antworten – sicherlich zum einen richtig, da sich Demokratien weltweit in der Krise befinden, zum anderen wohl auch seinem Lebensmittelpunkt geschuldet, den er sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch in Kanada besitzt. Er kam auf Donald Trump, Kamala Harris und die bevorstehenden Wahlen in den USA zu sprechen und beteuerte, dass sich eben auch Parteien veränderten. Damit meinte er gleichzeitig die AfD, die einst als „Pro-DM-Partei“ oder „Professorenpartei“ im Taunus gegründet politisch aktiv wurde. Den Grund für die Veränderungen nannte von Moltke nicht. Einige weitere Antworten auf Fragen blieben vage – just in dem Moment, in dem es konkret um die Menschen und die dazugehörigen Gründe ging, weshalb sie sich von der Demokratie aktuell abwenden. Der Blick auf die Welt schien zumindest ein paar Mal den Fokus auf den konkreten Moment der Menschen ein Stück weit abzuschwächen. Helmuth Caspar von Moltke lobte abschließend ausdrücklich und motivierend die Arbeit der Kreisau-AG: „Ihr tragt den Geist des Kreisauer Kreises weiter. Es freut mich ungemein, dass dort viele junge Menschen die Möglichkeit haben, Geschichte und Demokratie hautnah zu erleben“. Er appellierte daran, die anderen jungen Menschen aus anderen Ländern kennen- und schätzenzulernen und sich deren Sorgen in der „heutigen Welt“ anzuhören.
Abschiedsbriefe Gefängnis Tegel
„Anfang 2010 wurde bekannt, dass der Briefwechsel zwischen Helmuth James und Freya von Moltke aus den letzten Wochen vor seiner Hinrichtung wie durch ein Wunder komplett erhalten ist. Die politisch und persönlich offenherzigen Briefe, die vom Gefängnispfarrer Harald Poelchau unter Einsatz seines Lebens fast täglich an der Zensur vorbeigeschmuggelt wurden, sind das aufwühlende Zeugnis einer großen Liebe in den Zeiten des Widerstands gegen ein unmenschliches Regime“, heißt es im Klappentext des beim Verlag C.H. Beck erschienen Werks.
Liest man die Zeilen des Buchs nach und nach, wie es der Redakteur dieses Beitrags tat – anders ist es kaum möglich, da ein Durchatmen häufig unumgänglich ist –, wird die ganze Dramatik des Geschehens anhand des Briefwechsels des Ehe- und Liebespaars von Moltke noch anschaulicher, noch deutlicher, noch bedrückender. Und dennoch steckt in vielen der aneinandergereihten, bedeutungsschweren Buchstaben die ungebrochene Liebe beider zueinander. Das konnten die Nationalsozialisten nicht verhindern.
„Ich habe keine Furcht vor dem Tod, und ich habe animalische Angst vor dem Sterben“, schreibt Helmuth James. „Ich werde alt und anders werden, deshalb muss ich Dich in mir tragen und mit Dir leben“, antwortet Freya. Oft sind einzelne und konkret beschriebene Schicksale mit mehr Nachdruck in der Lage, die fürchterlichen und unmenschlichen Seiten eines Kriegs zu beschreiben als die schier unvorstellbar große Zahl von insgesamt 75 Millionen menschlichen Todesopfern während des Zweiten Weltkriegs. Deutlich mehr Zivilisten als Soldaten starben, darunter unzählige Kinder.