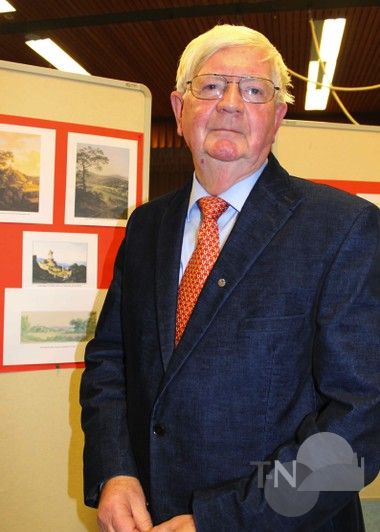Falkenstein (el) –Gerade in diesen Tagen, in denen wir wieder unsere Heizungen bis zum Anschlag aufdrehen, berühren uns Schicksale wie jene, die Hermann Groß in seinem Jahresvortrag im Falkensteiner Bürgerhaus schilderte. Von den schlimmen Zeiten und den Entbehrungen für die lokale Bevölkerung des „Kosakenwinters“ von 1813 wusste der Geschichtsexperte zu berichten – ein Thema, das ob seines nachdenklich stimmenden Charakters zum Volkstrauertag passte und eine der schwersten Zeiten in der Falkensteiner und Königsteiner Ortsgeschichte markiert.
Truppendurchzüge, Räubereien und Zwangseinqartierung – dem war die Bevölkerung im November und Dezember 1813 in erschütterndem Maße durch die Soldaten ausgesetzt, die sich wie die Franzosen unter Napoleon entweder auf dem Rückzug befanden oder durch jene, die sie, wie die furchterregenden Kosaken-Reiter, verfolgten.
Hermann Groß lässt das schreckliche Leiden der Bürger durch seinen „Hauptzeugen“, den evangelischen Lehrer Philipp Benack, wieder lebendig und greifbar werden. Der Lehrer hat vieles in seiner Chronik festgehalten, die französische Besatzung Königsteins und die Sprengung der Burg 1796 durch die Franzosen ebenso wie den Sommer 1800, als Holländer – damals Verbündete der Franzosen – an den Mühlen in Falkenstein eine große Wagenburg errichteten. Auch die Einquartierungen und die daraus resultierenden Forderungen der Soldaten und ihrer Kommandanten stellten die örtliche Bevölkerung nicht nur auf eine harte Probe, sondern ruinierten ihre Existenz für Jahre. Zeitweise, so berichtet Hermann Groß, seien sogar zwei Soldaten-Feldlager in Königstein aufgeschlagen worden. Einige Zahlen, die die Atmosphäre jener Zeit widerspiegeln: Im März 1805 befanden sich über 300 Franzosen im Dorf, die 164 Batteriepferde mitführten. All dies musste von der Gemeinde bezahlt werden, zumal die Einwohner im Vergleich zu den Einwohnern in der Unterzahl waren.
Auch an die Tür von Schultheiß Feger klopften die Soldaten und forderten Leinentücher und Stiefel. Dazu mussten die Sprachprobleme gelöst werden, die für so manches Missverständnis und Scharmützel sorgten.
1812 ging in die Geschichtsbücher als „russischer Winter“ ein. Die meisten starben nicht an Folgen der Kriegsauseinandersetzungen, sondern aufgrund von Hunger und Kälte. Napoleon war mit 620.000 Mann nach Russland gezogen und kehrte mit 120.000 Soldaten in die Heimat zurück. 1813 ereignete sich die Völkerschlacht bei Leipzig, ebenfalls mit Auswirkungen auf Königstein. Die Franzosen wurden verfolgt von Truppen der Alliierten, an deren Spitze die Kosaken, die zur preußischen Armee gehörten. „Die Jubelschreie der Befreiten verhallten schnell“, gab Hermann Groß den Tenor der Bürger in dieser Zeit wider. Auch Benack notierte in seiner Chronik, dass sie alles in ihren Besitz nahmen, „Gänse und Hühner mussten alle ihre Hälse hergeben“ und „kein Mensch war mehr Herr in seiner Wohnung“. Die Menschen versteckten sogar ihr Vieh im Wald. Aus einer Notiz des Königsteiner Stadtrates im Jahre 1813 an das herzogliche Justizamt ging hervor: Eine Kosakenpatrouille habe Fleisch, Brot, Wein und Schnaps verlangt und eine weitere Gruppierung wollte Schlachtvieh und als sie dieses nicht sofort präsentiert bekamen, sei die Belegschaft des Amtes misshandelt worden.
Einem Lehrer wurden sogar in der Königsteiner Schule die Stiefel von den Füßen gerissen. Die Vorräte waren aufgebraucht. Im November und Dezember jenes Jahres passierten an die 1.000 Soldaten und mehrere hundert Pferde Königstein, das damals 900 Einwohner zählte.
1813/14 ist auch bekannt als Hunger- und Kältewinter, der den Menschen zu ihrem Leid auch noch den Kriegs-Typhus beschert hat, an dem in Mainz, das damals fest in französischer Hand war, 20.000 Menschen starben. Erst später fand man heraus, dass diese Durchfall-Erkrankung durch die „Kleiderlaus“ übertragen wird bzw. durch deren Ausscheidungen. Auch im Königsteiner „Militärhospital“ – zu diesem war das Alte Rathaus umfunktioniert worden – lagen die Kranken und jene, die sie pflegten, nahmen die Krankheit, die buchstäblich in den Kleidern steckte, nichtsahnend mit nach Hause.
Auch einer der Hauptverfolger von Napoleon. General Blücher alias „General vorwärts“, bezog in diesen Tagen des Novembers 1813 Quartier in der heutigen Hauptstraße 21 (damals Gasthaus „Grüner Baum“). Auch dies war eine Folge des Nassauer Entschlusses, sich 1813 dem anti-französischen Lager anzuschließen. Denn die Gebietsveränderung sollte Folgen für die Königsteiner haben, die als Kurmainzer schlafen gingen und als Nassauer aufwachten. Die Falkensteiner waren dagegen schon immer Nassauer. 1817 wurde Lehrer Benack sogar die Grundlage des Unterrichtens entzogen: das Schuledikt sorgte für den Wegfall der konfessionell ausgerichteten Schule. Fortan sollte es eine Schule für alle geben.
Im Anschluss an den Vortrag, der übrigens seit 30 Jahren jedes Jahr mit einem anderen Schwerpunkt von Hermann Groß gehalten wird, konnte man in die damalige Zeit anhand von Schautafeln noch besser einsteigen. Heimatvereins-Vorsitzende Eva-Maria Dorn lud alle Interessierten hierzu ein und machte sie auch nochmal auf den Auftrag des Heimatvereins aufmerksam, Heimatgeschichte zu pflegen und zu bewahren. In diesem Zusammenhang habe der Verein in diesem Jahr bereits 15.000 Euro für die Falkensteiner Burg ausgegeben, berichtete Peter Majer-Leonhard, Dorns Vorgänger im Amt, und richtete gleichzeitig den Appell an die zahlreichen Zuhörer, die Bemühungen des Vereins doch mit dem Kauf von mit historischen Motiven versehenen Weihnachtskarten und Anstecknadeln zu unterstützen. Beides ist über den Heimatverein erhältlich..
Begeisterte seine Zuhörer wieder mit einem neuen Vortrag in Sachen Heimatgeschichte: Hermann Groß.
Foto: Schemuth